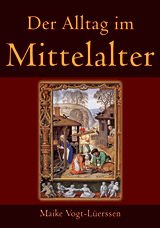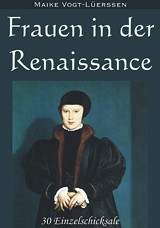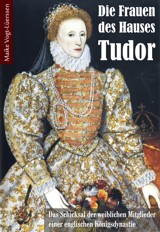Nach der großen Pestepidemie in den Jahren 1346 bis 1352 traten im 14. Jh. nicht nur im wirtschaftlichen Bereich drastische Veränderungen ein. Die Menschen, die dem Tod entgangen waren, hatten nur noch einen Wunsch, ihr Leben in vollen Zügen zu genießen. Und das machte sich auch in der Mode bemerkbar.
Bei den adligen Damen waren nun enganliegende Unterkleider und Oberkleider mit "Teufelsfenstern" gefragt. Diese "Teufelsfenster" waren seitliche, weite Öffnungen des Oberkleides, durch die man – dank der enganliegenden Unterkleider – einiges über den Körperbau der betreffenden Dame erfuhr.
Zudem wiesen einige Oberkleider zum erstenmal einen vorderen Knopfverschluß auf, und der Gürtel mußte nicht wie bisher die Taille zieren, sondern konnte lose auf den Hüften liegen. Dabei standen den Damen perlenbestickte Stoffgürtel oder schmale Ledergürtel zur Auswahl, an die man den Geldbeutel, das Schlüsselbund, das Gebetbuch, den Kasten mit dem Löffel und dem Messer – man nahm sein eigenes Besteck überall mit hin – , den Rosenkranz, eine Reliquie, ein Paar Handschuhe, eine Parfümdose und eine Schere mit Nadeldöschen hängen konnte. Außerdem wurde beim Oberkleid das vorne und hinten dreieckig gestaltende Dekolleté sowie das Tragen von Glöckchen oder Schellen an Rocksäumen, an der Gugel, am Gürtel und an den Schuhspitzen sehr beliebt.
Neben dem Tasselmantel trug man den Nuschenmantel, der vorne mit einer Spange, der Nusche, zusammengehalten wurde, oder die Heuke, einen ärmellosen Überwurf, den man über den Kopf legte, und dessen rechte Seite ziemlich großzügig über die linke Körperseite in Ellenbogenhöhe umgeschlagen und dort unsichtbar befestigt wurde. Worauf jedoch keine Frau mehr verzichten wollte, war – zum Entsetzen der Geistlichkeit – die Schleppe. Die Franziskaner waren so erbost über die "Teufelskleidung", daß sie den schleppetragenden Damen rundweg die Absolution verweigerten. Die Geistlichen führten jedoch gegen die Schleppen ebenso wie gegen zu weite Ausschnitte, zu kurze Röcke und zu enge Kleider, die ihrer Meinung nach die Sittsamkeit in Gefahr brachten, einen aussichtslosen Kampf.
Der Zisterziensermönch Cäsarius von Heisterbach (13. Jh.) erzählte unter Berufung auf einen glaubwürdigen Augenzeugen folgendes: In Mainz habe ein Priester, als er nach dem Sonntagsgottesdienst dem Volk das Weihwasser spendete, am Ausgang der Kirche plötzlich eine Dame erblickt, "die in einem prunkvollen Aufzug daherkam und mit allem möglichen Schmuck farbenprächtig wie ein Pfau aufgemacht war. Auf der überaus langen Schleppe ihres Kleides, die sie hinter sich herzog, sah er eine große Zahl von Teufeln sitzen. Sie waren klein wie Haselmäuse und schwarz wie die Mohren, sie vollführten ein lautes Gelächter und klatschten in die Hände und sprangen wie Fische im Netz zappelnd umher. Wahrhaftig: die Putzsucht der Frauen ist ein Netz des Teufels." (in: Sankt Elisabeth, Fürstin – Dienerin – Heilige, hrsg. von der Philipps-Universität, Sigmaringen 1981, S. 189)
Auch neue Haarfrisuren und Kopfbedeckungen wurden ausprobiert. Gefragt war z.B. das Gefrens, eine Fransenborte, die an einem Kopfreif befestigt war und den glatten Hinterkopf zwischen den Zöpfen- oder Schneckenfrisuren bedeckte (Abb. 21).
Die Haare flocht man nicht nur zu kunstvollen Haarmuscheln, sondern formte sie unter Verwendung von Haarnetzen auch zu Walzen, Kugeln oder Hörnern. Bedeckt wurden diese bizarren Frisuren – wie es sich für verheiratete Frauen gehörte – mit den unterschiedlichsten Hüten und Hauben.


Der Hennin (Abb. 22) stellt wohl die bekannteste Hutform des Spätmittelalters dar. Diese mehr oder weniger hohe kegelförmige Kopfbedeckung, die aus Metall oder steifem Leinen hergestellt und mit Brokat oder anderen wertvollen Stoffen überzogen wurde, setzte sich aus drei Teilen zusammen: einem feinen Tuch, dem Mandil, das die hoch ausrasierte Stirn und das Haupthaar bedeckte, einem spitzen oder stumpfen Kegel und einem manchmal bodenlangen Schleier, dem Flinder, der von der Spitze des Hutes herabfiel.



Auch die Schmetterlingshaube (Abb. 23), ein Hennin mit doppeltem, kunstvoll angebrachtem Schleier, und die Hörnerhaube (Abb. 24), eine Art Doppelhennin, standen in der Beliebtheitsskala ganz oben. In Oberitalien trugen die Damen außerdem noch den Balzo, einen großen Stoffwulst, der den Kopf turbanartig umgab. Auch Filzhüte – eigentlich für die Männer gefertigt – und der Kruseler schmückten das Haupt der Frauen.
Der Kruseler (Abb. 25) stellte ein halbkreisförmig zugeschnittenes Kopftuch dar, das an seiner das Gesicht rahmenden Fläche mit mehreren dichten Rüschen besetzt war. All diese Modeneuheiten des weiblichen Adels blieben jedoch im 14. Jh. nicht wie bisher auf ihren Stand beschränkt, sondern fanden große Nachahmung bei den reichen Patrizierinnen, den reichen Ehefrauen der Kaufleute und den reichen Handwerksfrauen. Selbst die ausgefallensten adligen Modeerscheinungen wurden von den reichen Bürgerinnen mit Begeisterung übernommen. So liefen die Frauen in der Stadt ebenfalls mit Schleppen, überlangen bauschigen Ärmeln und unzähligen Haubenarten herum. Und nach adligem Vorbild wurden ebenfalls die Augenbrauen gezupft, die Haare an der Stirn und an den Schläfen entfernt und mit Färberröte blond oder mit Henna und Indigo tiefschwarz gefärbt, das Gesicht mit einer Schminkfarbe aus Brombeersaft und Öl "gerouget" und die Finger mit Ringen überladen.
Als gegen Ende des 15. Jhs. die sozialen Unterschiede in der Kleidung trotz aller Verbote geringer wurden, versuchten die Adligen besonders mit kostbaren Schmuckstücken ihre "Höherwertigkeit" zu demonstrieren. Aber der Schmuck hatte noch andere Funktionen zu erfüllen, so diente er auch als Kapitalanlage und als Talisman.
Schließlich hieß es, der Diamant bewahre seinen Träger oder seine Trägerin vor jeglichem Schaden, der durch andere Menschen verursacht werden könnte. Schwangere Frauen sehen mit ihm einer glücklichen und leichten Geburt entgegen. Am linken Arm getragen, schütze er vor wilden Tieren, Gift und bösen Geistern. Der Rubin und der Balas halten Wacht über Hab und Gut ihres Trägers. Der Smaragd verhindere Augenkrankheiten, bewahre vor Fallsucht und schütze vor Blitzeinschlägen. Der Türkis verhindere den Verlust von Gliedmaßen. Der Saphir heile Geschwüre und erlöse von möglicher Gefangenschaft. Außerdem wirke er kleingemahlen als Abführmittel und helfe zudem gegen die Wassersucht. Der Granat bringe Glück, falls man vor Gericht zitiert werde, und befreie von Schwermut. Der Achat helfe gegen den Stich des Skorpions und mache, auf der linken Seite getragen, außerdem weise und angenehm. Zusätzlich soll er, wenn man ihn beim Schlafen unter den Kopf legt, viele Traumbilder erzeugen. Der Beryll helfe, zermahlen und mit Wasser getrunken, gegen Krankheiten der Leber, bewahre vor Feinden und erfreue das Herz. Der Gagat fördere die Geburt, der Topas halte seine Träger keusch, und der Chrysolith vertreibe die Melancholie. Doch wurden diese Edelsteine und Halbedelsteine wertemäßig noch vom Elektron, das aus den sieben Metallen Blei, Zinn, Eisen, Gold, Kupfer, Quecksilber und Silber gewonnen wurde, übertroffen. Aus ihm konnte man Gefäße, Leuchter, Waffen, Amulette, Glocken, Spiegel und Ringe herstellen. Und all diese Gegenstände schützten ihre Besitzer vor Gift und vor Feinden, da das Elektron in der Lage war, dessen bzw. deren Anwesenheit durch eine Farbveränderung anzuzeigen. Gegebenenfalls – so hieß es – mache es auch unsichtbar und offenbare zudem die Unzüchtigen und Ehebrecher.

Die Männermode des 14. und 15. Jhs. übertraf die Frauenmode sogar noch an Buntheit und Ideenreichtum. Dabei wurde der Männerrock im Laufe der Zeit immer kürzer. 1330 reichte er noch bis zu den Waden, 1350 bedeckte er schon nicht mehr die Knie, und 1364 endete er im Bereich der Hüften als Jacke, die Schecke (Abb. 26) genannt wurde. Diese Schecken fielen so eng aus, daß sie nicht mehr über den Kopf gezogen werden konnten. Man öffnete sie vorne und besetzte sie mit Knöpfen. Da der Idealmann im Spätmittelalter schmale Taille und breite Schultern besitzen mußte, boten die Schneider diese neue Jackenform im Taillenbereich sehr eng und im Brustraumbereich mit reichlich viel Baumwolle ausstaffiert zum Verkauf an.
Auch im Bürgertum fand die Schecke begeisterte Aufnahme. Ihre Ärmel waren glatt und bis zum Handgelenk enganliegend, erst dort erweiterten sie sich zu glockenförmigen, manchmal bis über die Fingerspitzen herabfallenden Manschetten, den Muffen. Wegen des großen Halsausschnittes trug man unter ihr oft ein feines, gefälteltes Hemd.
Der obligate Gürtel, mit einem Dolch, einem Messer und einem Geldbeutel versehen, befand sich nur noch lose auf der Hüfte.
Bei der Verkürzung des Oberrockes zur Schecke trat jedoch ganz nebenbei ein bedeutendes Problem auf. Bisher wurden die Beine mit langen Strümpfen bedeckt, die mit Nesteln am Gurt befestigt wurden. Der Anblick, der sich beim Tragen der kurzen Jacke nun bot, war für die Geistlichkeit schockierend. Auf deren dringliches Ermahnen hin ließ die Stadt Konstanz 1390 verordnen, daß die Männer, die Schecken tragen wollten, die Scham vorn und hinten zu bedecken hätten. Aus einer Mainzer Chronik von 1367 erfahren wir, daß man den jungen Männern mit ihren viel zu kurzen Jacken beim Bücken "in den Hintern" sehen konnte. Anscheinend wurden die Beinlinge so eng, daß die Herren auf ihre z.T. sackartigen Leinenunterhosen verzichten mußten. Aber warum trugen sie nicht die mittlerweile vorhandenen kurzen Unterhosen, oder malten die Geistlichen wieder einmal den Teufel an die Wand und sahen Fleisch, wo keines war?

Im Laufe des 15. Jhs. nähte man die ledernen oder wollenen Strümpfe endlich zu einer enganliegenden Strumpfhose zusammen, die entweder nur hinten oder vorn und hinten ihre Nähte zeigte und im vorderen Schambereich mit einem dreieckigen Hosenlatz (Abb. 27) versehen wurde. Beliebt waren Strümpfe oder Strumpfhosen, die aus dem sehr dehnbaren Scharlach gefertigt waren und die Farben Rot, Braun, Blau, Grün oder Weiß aufwiesen. Und das Tragen von einem Paar unterschiedlich gefärbter Strümpfe galt immer noch als ausgesprochen "schick". Wie wahre Paradiesvögel liefen die spätmittelalterlichen Männer durch die Gassen ihrer Städte!
Während wir Frauen heute dank der Erfindung der Büstenhalter zum Schauobjekt der Männer geworden sind, konnte sich das weibliche Geschlecht im Mittelalter und auch noch in der frühen Neuzeit am Männlichsein des anderen Geschlechtes satt sehen. Denn die Herren von damals verbargen ihre Schätze nicht unter einer trostlosen Mode. Mit Schleifen und Fransen an den Hosenlätzen wurde gerade das betont, was die Geistlichkeit so gern verhüllt gesehen hätte. Im Laufe des 15. Jhs. wurde der Hosenlatz sogar noch vergrößert und entwickelte sich weiter zur Schamkapsel oder Braguette, die im 16. Jh. die Größe eines Kinderkopfes erreichen konnte. In Spanien sollen die Männer um 1560 "mit einem nie mehr zu überbietenden Grad an Deutlichkeit" das kostbare, männliche Geschlechtsteil ausstaffiert haben. Und obwohl es schon im 15. Jh. eine ganze Flut von Strafpredigten und Moralvorschriften gab, blieben die adligen und bürgerlichen Herren ihren Schamkapseln (Abb. 28) bis zum Ende des 16. Jhs. treu.

Der Bischof Musculus aus Frankfurt schrieb im Jahre 1555 dazu folgendes: "Unsere jungen Kumpanen lassen den Latz vorn mit dem Höllenfeuer und dem Lappen über die Maßen groß machen, so daß der Teuffel darin sitzt und zu allen Seiten hinausschaut, allein zum Ärgernis und bösen Beispiel, ja zur Verlockung und Verführung armer, wahnsinniger und unschuldiger Mädchen." (in: Erika Thiel: Geschichte des Kostüms, Berlin 1980, S. 170).
Neben den oben beschriebenen kurzen Jacken wurden im Spätmittelalter auch noch lange Gewänder getragen – und zwar besonders von der Geistlichkeit und den älteren, angesehenen Herren.
So waren für die Männer im 14. und 15. Jh. Mäntel in sämtlichen Längen verfügbar. Modelle, die bis zum Boden reichten, wurden mit Hängeärmeln und einer Schleppe ausgestattet. In Frankreich wurde ein vorne offener Mantel, "Houppelande" genannt, beliebt, der im Taillenbereich mit einer Schnur umgürtet wurde.
Neben der Houppelande war seit der zweiten Hälfte des 14. Jhs. noch ein kreisförmiger Mantel besonders gefragt: die Heuke, die auf der rechten Seite von oben bis unten aufgeschlitzt war und im Gegensatz zum gleichnamigen Mantel der Frauen auf der rechten Schulter mit Hilfe eines Knopfes zusammengehalten wurde.

Der beliebteste Mantel des 15. und 16. Jhs. war die Schaube (Abb. 29) mit ihrem großen Pelzkragen, der oft weit über die Schultern reichte. Angefertigt wurde die teure Schaube aus schwarzen, seltener grauen, braunen oder roten, feinen Wollstoffen, und für kältere Jahreszeiten wies sie ein zusätzliches Pelzinnenfutter auf.
Im Spätmittelalter ließen die Menschen – was die Mode betraf – ihrer Phantasie freien Lauf. Man entwarf Tüten-, Sack-, Puff-, Beutel-, Schlitz-, Bausch-, Keulen- und andere Ärmeltypen und versah die Ärmelausschnitte, die Hüte und die Kleider mit ausgezackten Lappen, worunter man in der Modefachsprache dann ein "gezaddeltes" Gewand verstand.
Im 15. Jh. wurde das Herzogtum Burgund in der Mode tonangebend. Die adligen Herren kleideten sich hier mit reichen und schweren Stoffen wie Gold- und Silberbrokaten. Die offizielle burgundische Hoffarbe wurde jedoch das Schwarz. Denn, um bei all diesen kostbaren und bunten Gewändern noch aufzufallen, blieb gar keine andere Farbe mehr übrig.
An Kopfbedeckungen waren bei den Männern nun das Barett, die Gugel, der Filzhut und die Sendelbinde im Gebrauch. Auch turbanartige Konstruktionen verhüllten ihre Häupter.
Das Barett (Abb. 30), das gegen Ende des 15. Jhs. die beliebteste Kopfbedeckung wurde und das im 16. Jh. sogar bei den Frauen großen Anhang fand, konnte um 1520 alle anderen Formen an Hüten in die untersten Stände verdrängen. Die ersten Baretts waren noch recht klein und mit einer hinten angebrachten Krempe versehen, aber schon bald nahmen sie beträchtliche Ausmaße an und wurden mit Federn, Bändern, Edelsteinen und Broschen geradezu überladen und nur noch seitlich am Kopf getragen.
Der Filzhut, auch Biberhut genannt, bestand aus Biberhaaren und war wegen seines hohen Preises nur den Reichsten vorbehalten.
Die Sendelbinde (Abb. 31), die aus leichtem Seidenstoff angefertigt wurde, konnte unterschiedlich getragen werden. Entweder hing die Binde dieser Kopfbedeckungsart seitwärts lang herab, oder sie wurde turbanartig um den Kopf gebunden, wobei das freie Ende hoch emporragen sollte.
Die Gugel, die schon im 12. und 13. Jh. getragen wurde, erhielt auf ihrer Rückseite einen "Schwanz", der so lang wurde, daß verschiedene städtische Magistrate glaubten, dagegen vorgehen zu müssen. Diesen langen "Gugelschwanz" konnte man – je nach Lust und Laune – um den Hals legen oder turbanartig um den Kopf wickeln.
In der Hutmode gab es bei den Männern wie bei den Frauen keine Grenzen! Die Italiener z.B. bevorzugten im 15. Jh. fezartige Kappen.



Auf die Pflege ihrer Haare legten die Männer im 14. und 15. Jh. ebenfalls großen Wert. Mit Brenneisen und Eiweiß wurden die Haarsträhnen gelockt oder gekräuselt. Im Gegensatz zu den vorigen Jahrhunderten ließen die jungen Herren ihre Haare nun sehr lang wachsen. Bart trug man im Spätmittelalter jedoch selten, und wenn - dann färbte man ihn häufig knallrot! Nur bei den Königen und Fürsten waren Bärte wie der Kinn- und der Knebelbart beliebt. In Frankreich ließen die Adligen ihre Bärte zu zwei Spitzen frisieren.
In Burgund wurde in der zweiten Hälfte des 15. Jhs. eine neue Haarfrisur eingeführt, die einer kappenartigen Perücke (Abb. 32) glich und bei der stets auf einen Bart verzichtet wurde.
Wie im Hochmittelalter war der Schnabelschuh auch im Spätmittelalter die beliebteste Schuhform. Nur die Länge der Schuhspitzen war mittlerweile genau vorgeschrieben. So durften Fürsten und Prinzen Schuhspitzen von 2 1/2 Fuß, höhere Adlige von 2 Fuß, einfache Ritter von 1 1/2 Fuß, reiche Bürger von 1 Fuß und gewöhnliche Leute von 1/2 Fuß Länge besitzen. Aus dieser Zeit stammt auch der bekannte Ausspruch: auf großem Fuß leben.
Neben den Schnabelschuhen boten die Schuster noch knöchelhohe Halbschuhe und -stiefel, die auf einer ihrer Seiten geschnürt oder geknöpft wurden, und einfache Ledersohlen an. Letztere wurden durch Riemen an der Lauffläche der Strümpfe befestigt. Als gegen Ende des 15. Jhs. die Schnabelschuhe endlich außer Mode gerieten, traten die Kuhmaul- und Hornschuhe (Abb. 29) an ihre Stelle.
Im Spätmittelalter änderte sich auch die Ritterrüstung. Neben den Schwertern und Lanzen verwendete man in den Kämpfen Streit- oder Mordäxte, Sensen, Glefen (kurze Speere mit Widerhaken), Morgensterne und Stechdolche. Zwar wurden diese Waffen ebenso wie die Armbrust und der Pfeil und Bogen eines Ritters für unwürdig gehalten, ja der Papst bezeichnete die Benutzung von Pfeil und Bogen und Armbrust sogar für unchristlich, aber das hinderte die Ritter nicht im geringsten, sie trotzdem zu verwenden. Ein geübter Schütze konnte 10 - 12 Pfeile pro Minute abschießen und mit einem englischen Langbogen noch in einer Entfernung von 250 m sicher sein Ziel treffen, und ein Fachmann auf dem Gebiet des Armbrustschießens konnte mit dieser im Durchschnitt 8 kg schweren Waffe ein bis zwei Eisenbolzen pro Minute abschießen und verfehlte sein Opfer auf 100 m Entfernung todsicher nicht. So ist es kein Wunder, daß bei diesen Waffen und ihrer ständigen Weiterentwicklung der Ringpanzer aus dem 12. und 13. Jh. nur noch ungenügenden Schutz bot und verstärkt werden mußte.
Zunächst versuchte man, das Kniegelenk, die Beine, die Füße, die Arme und den Hals durch zusätzliche Eisenplatten vor Verletzungen zu sichern. Außerdem wurde ein neuer Waffenrock, Lendner genannt, aus Leder angefertigt, den man stark polsterte und innen und außen ebenfalls mit eisernen Platten versah.
Gegen Ende des 14. Jhs. fügte man die bisher immer noch einzelnen Plattenteile zum Brustharnisch zusammen. Diese Harnischform bestand nur noch aus einem Brustteil und zwei Rückenteilen, die durch Scharniere miteinander verbunden wurden. Im Laufe des 15. Jhs. trug der Ritter schließlich den Plattenharnisch, der im Gegensatz zum alten Brustharnisch auch den Unterkörper besser schützen konnte.

Hergestellt wurden die Rüstungen vom Waffenschmied (Abb. 33), der nicht nur die Einzelteile des Plattenharnischs dem Körperbau des künftigen Trägers genauestens anzupassen, sondern auch das Muskelspiel an den Armen und den Beinen zu berücksichtigen hatte. Denn der Kämpfer durfte in seiner Bewegungsfreiheit nicht völlig eingeschränkt werden. Aus diesem Grund blieben z.B. die Kniekehlen und Achsenhöhlen weiterhin ungepanzert und mußten durch eiserne Maschengeflechte, die auf Leinenstoff aufgenäht wurden, gegen eventuelle Verletzungen gesichert werden. Bevor der Ritter seinen "Panzermaßanzug" vom Waffenschmied ausgehändigt bekam, mußten die Rüstungen noch Probebeschüsse oder Schläge mit schweren Stangen über sich ergehen lassen. In Frankreich erhielten die Rüstungen im 14. Jh., die solche Härtetests überstanden hatten, Kontrollmarken.
Zwar durften sich die Ritter in diesen Plattenpanzern, die im 16. Jh. aus 160 - 180 Einzelteilen bestanden und die bis zu 46 kg wiegen konnten, beim Kämpfen sicherer fühlen, aber es gab auch eine Menge Nachteile. Beim Anlegen und Ablegen der Rüstung benötigte man mindestens zwei Helfer. Außerdem machte das Gehen große Schwierigkeiten, wozu auch die Helme beitrugen, die nur schmale Sehschlitze besaßen. Fiel man vom Pferd oder durch andere unglückliche Zufälle zu Boden, war man hilflos wie eine auf dem Rücken liegende Schildkröte. Der unbequeme Topfhelm aus dem 13. Jh. wurde im 14. Jh. durch die Beckenhaube und die Hundsgugel mit aufklappbarem Visier ersetzt. Die Sichtverhältnisse blieben jedoch auch bei diesen Helmformen wie bisher sehr bescheiden.
Da sich im Spätmittelalter die wirtschaftliche Lage der Handwerker und der Bauern verbessert hatte, stieg auch in diesen Kreisen das Interesse für die Mode. Natürlich richtete man sich nach dem Modegeschmack des Adels. Welche Ärmel die (reichen) Bauern z.B. an ihre Gewänder nähen ließen, erfahren wir aus folgender Quelle: "Bei andern (Bauern) war der linke Arm weiter als der rechte, ja sogar bei manchen weiter als der ganze Rock lang war. Andere hatten beide Ärmel von solcher Weite, und wieder manche zierten den linken Ärmel auf verschiedene Weisen, theils mit Bändern von allerlei Farben, theils mit silbernen Röhrlein an seidenen Schnüren ..." (in: René König und Peter W. Schuppisser: Die Mode in der menschlichen Gesellschaft, Zürich 19612, S. 48)
Die Kleider der Bäuerinnen verloren im 14. und 15. Jh. ihren hemdartigen Schnitt und paßten sich der Form des Oberkörpers an. Viele Bäuerinnen konnten sich zum erstenmal ein zusätzliches kürzeres Oberkleid oder zumindest eine Schürze leisten.
Selbst die Kleidung der weniger wohlhabenden Bauern bestand nicht mehr nur aus dem Hemdkittel und den langen und weiten Hosen, sondern erweiterte sich um einen kurzen, gegürteten Mantel mit Kapuze, eine ärmellose Weste und eine enge Hose.
Die Mode wurde eine Leidenschaft, die jedes Land und jeden Stand in Europa ergriff. Bei dieser Entwicklung sah sich der Adel natürlich immer mehr seiner Modeexklusivität beraubt. So erfährt man in einer Verordnung König Karls VII. von Frankreich († 1461) folgendes: "Es ist dem König vorgestellt worden, daß von allen Nationen der Erde keine so entartet ist, keine so veränderlich, so unmaßend, so maßlos und unbeständig in der Kleidung wie die französische, und daß man vermittelst der Kleider nicht mehr den Stand und Rang der Leute erkennt, ob sie Prinzen sind oder Edelleute oder Bürger oder Handwerker, weil man es duldet, daß jeder nach seinem Vergnügen sich kleidet, Mann wie Frau, in Gold- und Silberstoff, in Seide oder Wolle, ohne Rücksicht auf seinen Stand zu nehmen." (in: Erika Thiel, ebenda, S. 122/123)
Ja die Kleidung schien ihre Bedeutung als Standessymbol zu verlieren. Die Regensburger Bürgerin Diemut Hiltprand, geb. Neumburger, besaß z.B. laut ihres Testamentes vom 26.6.1308 einen grünen und einen braunen Mantel, drei Sukenien (kurze, ärmellose Übergewänder), von denen eines aus Seide, ein anderes aus Scharlach war, zwei dazu passende Untergewänder, einen pelzverbrämten Rock, einen Pelzrock und zwei lange Oberkleider, von denen eines sogar mit Perlen bestickt war. An Schmuck verfügte sie unter anderem über drei silberne Gürtel und fünf goldene Spangen.
Die Obrigkeit versuchte sich, mit Hilfe neuer Gesetze gegen diesen "bürgerlichen" Luxus zu wehren. So erließ sie zunächst in Frankreich, Spanien und Italien und in der zweiten Hälfte des 14. Jhs. auch in Deutschland sogenannte Kleiderordnungen. Der Magistrat oder der Landesherr verkündete, daß durch den Kleiderluxus nicht nur die Standeszugehörigkeit verwischt wäre, sondern auch viele Bürger stark verschuldet bzw. in finanzielle Notlagen geraten wären, da sie ihren Lohn und sogar ihren Notpfennig für den Kauf kostbarer Kleidungs- und Schmuckstücke verwendet hätten.
Eine Konstanzer Kleiderordnung aus dem Jahre 1390 verbot deshalb ihren Bürgerinnen folgendes zu tragen:
- Hauben, die mit Perlen, Edelsteinen, goldenen Ringen und Schleifen im Werte von mehr als 50 Gulden geziert waren (für einen Gulden erhielt man damals 100 Pfund Rind- oder Kalbfleisch),
- Schmuck einschließlich silberbeschlagene Gürtel und kostbare Halsbänder (nur der Ehering war erlaubt!)
- Schleppen und Gewänder, die mehr als zwei Farben aufwiesen.
In einer Kleiderordnung aus Speyer im Jahre 1356 wurde das Tragen von ungewohnten Haartrachten, üppigen Kopftüchern, Hutverzierungen, auffälligen Lappen an den Ärmeln, Zaddeln an Mützen und Schuhen, eng geschnürten Kleidern, großen Halsausschnitten, die die Schultern nicht mehr bedeckten, Schnabelschuhen und bei den Männern von Röcken, die so kurz waren, daß man die Knie sehen konnte, unter Strafe gestellt.
Die Obrigkeit von Straßburg wollte auf ausdrücklichen Wunsch der Geistlichkeit gegen Ende des 14. Jhs. die enggeschnürten und weitausgeschnittenen Kleider abschaffen. Ebenfalls auf Wunsch der Geistlichkeit verordneten die Städte Ulm im Jahre 1420 und Konstanz im Jahre 1439, daß die Frauen ihren Hals unter Mänteln, Kleidern oder Schleiern zu verbergen hätten.
Übertrat man diese Kleiderverbote, mußte man mit recht hohen Geldbußen rechnen. Zur Überwachung der Kleiderordnungen stellten einige Städte Stadtknechte ein oder förderten einfach durch hohe Belohnungen innerhalb der Bevölkerung die Denunzierung.
In Venedig, das zwischen 1450 und 1500 eine außerordentliche Blütezeit mit dem entsprechenden Anwachsen der Privatvermögen erlebte, wurde in dieser Zeit alle zweieinhalb Jahre eine größere oder kleinere Luxusverordnung erlassen. Aber in manchen Städten waren die Gesetze so angelegt, daß jedem Übertreter bei Zahlung einer Gebühr oder einer Buße ein Hintertürchen zur Benutzung von verbotenen Kleidungsstücken offenblieb, so daß hier die Luxusgesetzgebung eher den Charakter einer Sondersteuer annahm.
Dennoch folgte im 14. und 15. Jh. eine Kleiderordnung nach der anderen, ohne das von Erfolgen gesprochen werden konnte. Die Obrigkeit wurde trotzdem nicht müde, bis in die zweite Hälfte des 18. Jhs. hinein Kleiderordnungen zu erlassen.
Auch die Geistlichkeit ließ nicht locker! Aber ihr Kampf besonders gegen das weibliche Dekolleté blieb ebenfalls erfolglos. Im 16. Jh. waren große Ausschnitte sogar gefragt wie nie zuvor. Die Hofdamen von Katharina von Medici († 1589), der Königin von Frankreich, trugen schließlich Kleider, die selbst die Brustwarzen unbedeckt ließen.
"Die Busenknospen werden oft mit diamantbesetzten Ringen und Käppchen geziert, die Busenhügel durch goldene, mit Kreuzen und Schmucksachen beschwerte Kettchen miteinander verbunden ..." (in: René König und Peter W. Schuppisser, ebenda, S. 57).
Katharina von Medici ordnete für ihre Hofdamen sogar Oberkleider an, die speziell den Busen unverhüllt ließen.
Bisher blieb in der Darstellung der unterschiedlichen Modetrends nur noch die Kinderkleidung unerwähnt. Aber im Gegensatz zu heute gab es damals noch keine spezielle Mode für die Kinder. Die Jungen und Mädchen erhielten die gleichen Frisuren und trugen die gleichen Kleidungsstücke wie die Erwachsenen.
Gegen Ende des 15. Jhs. änderte sich die Mode der Erwachsenen erneut. Die Männer zeigten Interesse an den Rundungen des weiblichen Geschlechtes, das sofort modemäßig seinen Niederschlag fand. So wurden durch die neuen Kleider die breiten Hüften der Frauen betont oder, falls sie fehlten, durch breite Wulste vorgetäuscht. Bauschärmel, breite Mäntel und hohe, mit künstlichen seidenen Haaren durchsetzte Frisuren gehörten zur reifen, heißblütigen Frau, deren üppige Formen die Sinne des Mannes betören sollten. Zusätzlich trennte man das Frauenkleid zum ersten Mal in Leibchen und Rock. Die Schuhe verloren außerdem ihre übertriebenen Spitzen und paßten sich dem Fuß an. Jedoch das non plus ultra für jede Dame und für jeden Herrn wurden die Handschuhe aus Seide, die mit Gold und Perlen bestickt und stets reichlich parfümiert waren. Mit ihnen, dem Dekolleté und den Schamkapseln verließen die Menschen das, was die Historiker als das Mittelalter bezeichneten, und schritten in die "Neue Zeit".